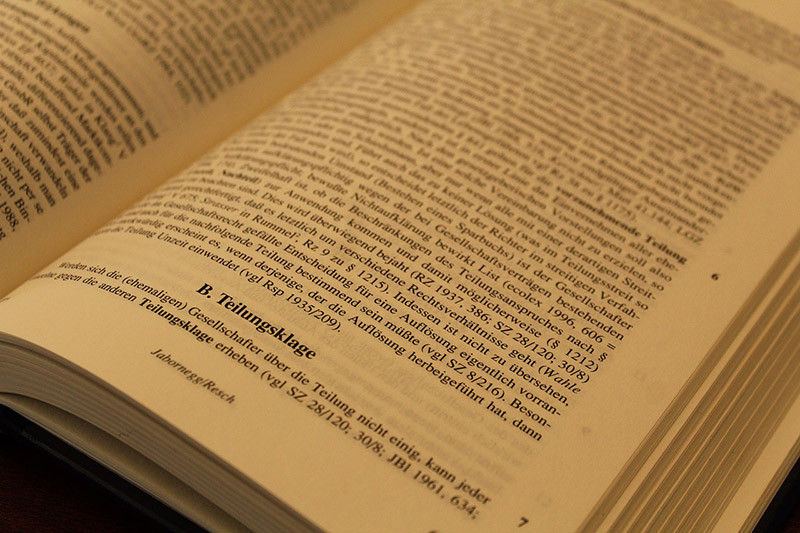Rechtssicher einstellen: Ausländerbeschäftigungsgesetz, AMS-Verfahren, Lohn- und Meldepflichten kompakt erklärt
Ein Bekannter, der einen Metallbaubetrieb in Niederösterreich führt, hat letztes Jahr einen polnischen Schweißer eingestellt – ohne vorher beim AMS nachzufragen. Die Strafe: 5.000 Euro. Der Mann hatte alle Papiere, eine gültige Aufenthaltsbewilligung, aber keine Beschäftigungsbewilligung. Ein Detail, das teuer wurde. Solche Fälle häufen sich, weil viele Arbeitgeber die rechtlichen Feinheiten nicht kennen oder unterschätzen. Dabei ist die Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte in Österreich präzise geregelt – und wer die Regeln kennt, spart sich Ärger und Geld.
Wer braucht überhaupt eine Bewilligung?
Nicht jeder ausländische Arbeitnehmer braucht eine Beschäftigungsbewilligung. EWR-Bürger (also EU-Staaten plus Island, Liechtenstein, Norwegen) und Schweizer können ohne weitere Genehmigung in Österreich arbeiten. Sie haben Freizügigkeit – fertig. Gleiches gilt für anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte, die eine Rot-Weiß-Rot-Karte plus haben.
Komplizierter wird es bei Drittstaatsangehörigen. Ein Serbe, eine Ukrainerin, ein Inder – sie alle brauchen eine Arbeitserlaubnis. Welche genau, hängt von der Qualifikation und dem Aufenthaltsstatus ab. Die Rot-Weiß-Rot-Karte für Fachkräfte, die Blaue Karte EU für Hochqualifizierte, oder die klassische Beschäftigungsbewilligung für sonstige Arbeitskräfte. Jede Kategorie hat eigene Voraussetzungen, eigene Quoten, eigene Verfahren.
Die Rot-Weiß-Rot-Karte und ihre Tücken
Die Rot-Weiß-Rot-Karte (RWR-Karte) ist das österreichische Punktesystem für qualifizierte Zuwanderer. Sie funktioniert nach einem Kriterienkatalog: Alter, Ausbildung, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Studium in Österreich. Wer genug Punkte sammelt, bekommt die Karte. Klingt einfach, ist es aber nicht.
Ein Beispiel: Ein IT-Spezialist aus der Ukraine, 32 Jahre alt, mit Masterabschluss und fünf Jahren Berufserfahrung, bewirbt sich bei einem Wiener Software-Unternehmen. Er braucht mindestens 70 Punkte. Für sein Alter bekommt er 20 Punkte, für den Master 20, für die Berufserfahrung 10, für das Jobangebot 10. Zusammen 60 Punkte – zu wenig. Erst wenn er A1-Deutschkenntnisse nachweist (weitere 10 Punkte) oder ein höheres Gehalt vereinbart wird, klappt es.
Die Beantragung läuft über das AMS und die zuständige MA 35 in Wien (oder die Landesregierung außerhalb Wiens). Dauer: drei bis sechs Monate, manchmal länger. Während dieser Zeit darf der Bewerber noch nicht arbeiten. Das ist für Unternehmen, die dringend Personal brauchen, ein Problem. Gerade bei der Rekrutierung von Arbeitskräften aus dem Ausland ist die lange Wartezeit ein Hindernis, das viele unterschätzen.
Beschäftigungsbewilligung: Der klassische Weg
Für Arbeitskräfte, die nicht über die RWR-Karte kommen, gibt es die Beschäftigungsbewilligung nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz. Hier muss der Arbeitgeber beim AMS einen Antrag stellen – und zwar bevor der Arbeitnehmer zu arbeiten beginnt. Die Bewilligung ist personenbezogen und betriebsbezogen: Sie gilt nur für diesen einen Arbeitnehmer, in diesem einen Betrieb, für diese eine Tätigkeit.
Das AMS prüft dabei die sogenannte Arbeitsmarktlage. Gibt es in Österreich verfügbare Arbeitskräfte, die den Job machen könnten? Falls ja, wird die Bewilligung abgelehnt. Diese Prüfung entfällt nur in Mangelberufen oder wenn der Betrieb nachweisen kann, dass er intensiv gesucht, aber niemanden gefunden hat. Eine dokumentierte Inseratenschaltung über das AMS ist dabei hilfreich.
Die gesetzlichen Grundlagen finden sich im österreichischen Ausländerbeschäftigungsgesetz, das detailliert regelt, wer unter welchen Bedingungen beschäftigt werden darf. Das Gesetz ist komplex, mit zahlreichen Ausnahmen und Sonderregelungen – eine Lektüre, die sich bei regelmäßiger Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte lohnt.
Kontingente und Quoten verstehen
Österreich hat ein Quotensystem. Jedes Jahr wird festgelegt, wie viele Beschäftigungsbewilligungen vergeben werden dürfen. Für 2024 liegt die Bundeshöchstzahl bei rund 5.000 neuen Bewilligungen für Drittstaatsangehörige. Zusätzlich gibt es etwa 1.500 Plätze für Saisoniers in der Tourismusbranche.
Wer zu spät kommt, geht leer aus. Die Quoten werden meist schon im ersten Quartal ausgeschöpft. Unternehmen, die im Oktober einen Antrag stellen, haben kaum noch Chancen. Einzige Ausnahme: Mangelberufe. Für bestimmte Berufe – etwa Pflegekräfte, Facharbeiter in der Metallverarbeitung, manche IT-Berufe – gibt es erleichterte Zugänge oder eigene Kontingente.
Die Baubranche ist ein gutes Beispiel für die Problematik. Der Fachkräftemangel ist enorm, gleichzeitig sind die Quoten begrenzt. Viele Betriebe weichen deshalb auf entsandte Arbeitnehmer aus – eine legale, aber teurere Variante, bei der ein ausländisches Unternehmen seine Mitarbeiter nach Österreich schickt.
AMS-Verfahren Schritt für Schritt
Das konkrete Verfahren beim AMS läuft so ab: Der Arbeitgeber reicht den Antrag online über das eAMS-Konto ein. Notwendige Unterlagen: ausgefüllter Antrag, Kopie des Reisepasses des Arbeitnehmers, Arbeitsvertrag, Qualifikationsnachweise, bei Bedarf Nachweise über erfolglose Vermittlungsbemühungen.
Das AMS prüft zunächst die Arbeitsmarktlage. Gibt es inländische Arbeitskräfte? Ist der Lohn kollektivvertragskonform? Sind die Arbeitsbedingungen in Ordnung? Diese Prüfung dauert offiziell vier bis sechs Wochen, in der Praxis oft länger. Bei unvollständigen Unterlagen wird nachgefordert, was weitere Verzögerungen bringt.
Ein häufiger Fehler: Der Arbeitgeber meint, mit der Antragstellung könne der Mitarbeiter schon anfangen. Falsch. Die Beschäftigung darf erst nach Erhalt der Bewilligung beginnen. Wer das ignoriert, begeht illegale Beschäftigung – Strafen beginnen bei 1.000 Euro pro Arbeitnehmer und Tag, können aber bis zu 50.000 Euro gehen.
Meldepflichten: Was wann wo gemeldet werden muss
Mit der Einstellung beginnen die Meldepflichten. Erste Station: Die Anmeldung bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Diese muss vor Arbeitsantritt erfolgen, online über ELDA (Elektronischer Datenaustausch). Wer einen Arbeitnehmer ohne Anmeldung beschäftigt, riskiert empfindliche Strafen – die Kontrollen haben sich in den letzten Jahren massiv verschärft.
Bei ausländischen Arbeitnehmern kommt die Registrierung bei der zuständigen Behörde hinzu. In Wien ist das die MA 35, in den Bundesländern die jeweilige Landesregierung. Diese Meldung ist innerhalb von drei Tagen nach Einreise verpflichtend. Viele Arbeitgeber wissen das nicht und verlassen sich darauf, dass der Arbeitnehmer das selbst regelt – ein Fehler, denn rechtlich haftet auch der Arbeitgeber.
Zusätzlich gilt die Lohn- und Sozialdumpingprüfung. Bei Arbeitnehmern aus dem Ausland müssen Lohnzettel, Arbeitsverträge und Zeitaufzeichnungen besonders sorgfältig geführt werden. Die Finanzpolizei kontrolliert verstärkt – vor allem in Branchen wie Bau, Gastronomie und Reinigung. Ein fehlender Stundennachweis oder eine unklare Lohnabrechnung kann bereits ausreichen für ein Verfahren.
Lohnpflichten: Gleichstellung und Kollektivvertrag
Ein zentraler Punkt ist die Lohngleichheit. Ausländische Arbeitnehmer haben Anspruch auf denselben Lohn wie österreichische für vergleichbare Tätigkeiten. Das klingt selbstverständlich, wird aber oft missachtet. Das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG) sieht empfindliche Strafen vor, wenn Arbeitnehmer unter Kollektivvertrag bezahlt werden.
Ein konkretes Beispiel: Ein rumänischer Maler wird mit 1.200 Euro brutto pro Monat angestellt. Der Kollektivvertrag für Maler sieht aber mindestens 1.800 Euro vor. Das Unternehmen spart sich 600 Euro – und kassiert eine Strafe von bis zu 10.000 Euro pro Arbeitnehmer, wenn es erwischt wird. Die Nachzahlung der Lohndifferenz kommt obendrauf.
Besonders kompliziert wird es bei entsandten Arbeitnehmern. Ein slowakisches Bauunternehmen schickt Arbeiter nach Österreich, zahlt aber slowakische Löhne. Das ist illegal. Auch entsandte Arbeitnehmer haben Anspruch auf österreichisches Lohnniveau. Die Kontrolle erfolgt über die Lohn- und Sozialdumping-Prüforgane, die mittlerweile sehr aktiv sind.
Aufzeichnungspflichten und Dokumentation
Die Aufzeichnungspflichten gehen über normale Arbeitszeitaufzeichnungen hinaus. Bei ausländischen Arbeitnehmern muss zusätzlich dokumentiert werden: Kopie der Beschäftigungsbewilligung, Kopie des Aufenthaltstitels, Nachweis der ordnungsgemäßen Anmeldung, lückenlose Arbeitszeitaufzeichnungen, Lohnunterlagen.
Diese Unterlagen müssen am Arbeitsplatz oder im Betrieb verfügbar sein. Bei einer Kontrolle durch die Finanzpolizei müssen sie sofort vorgelegt werden können. Wer die Unterlagen nicht griffbereit hat, bekommt eine Nachfrist – und im Wiederholungsfall eine Strafe.
Ein Tipp aus der Praxis: Ein eigener Ordner pro ausländischen Mitarbeiter, in dem alle relevanten Dokumente chronologisch abgelegt sind. Bei einer Kontrolle spart das Nerven und Zeit. Außerdem empfiehlt sich eine Checkliste, auf der alle erforderlichen Schritte abgehakt werden: Bewilligung beantragt, Bescheid erhalten, ÖGK-Anmeldung durchgeführt, Aufenthaltstitel geprüft, Lohnunterlagen erstellt.
Sanktionen: Was droht bei Verstößen?
Die Strafen sind gestaffelt. Illegale Beschäftigung: 1.000 bis 10.000 Euro pro Arbeitnehmer, bei Wiederholung 2.000 bis 20.000 Euro. Lohn- und Sozialdumping: bis zu 10.000 Euro für leichte Verstöße, bis zu 50.000 Euro bei schweren oder wiederholten Verstößen. Fehlende oder fehlerhafte Aufzeichnungen: 500 bis 5.000 Euro.
Zusätzlich drohen strafrechtliche Konsequenzen. Wer systematisch illegale Beschäftigung betreibt oder Arbeitnehmer ausbeutet, macht sich strafbar – bis hin zu Freiheitsstrafen. Die Behörden nehmen das Thema ernst, die Kontrolldichte hat sich in den letzten Jahren vervielfacht.
Ein Unternehmen aus Oberösterreich wurde 2023 mit einer Gesamtstrafe von 180.000 Euro belegt, weil es zwölf rumänische Arbeitnehmer ohne Bewilligung beschäftigt und unter Kollektivvertrag bezahlt hatte. Das Unternehmen musste zusätzlich die Lohndifferenzen nachzahlen – insgesamt über 250.000 Euro. Eine Summe, die viele Betriebe in die Insolvenz treibt.
Die Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte ist kein Hexenwerk, aber sie erfordert Sorgfalt. Wer die Regeln kennt, die Fristen einhält und die Dokumentation im Griff hat, fährt sicher. Wer hingegen schlampig arbeitet oder versucht, Abkürzungen zu nehmen, zahlt am Ende drauf – finanziell und rechtlich.
Bild von Monika Robak auf Pixabay
About the author
Bezahlter Inhalt - Kennzeichnung entgeltlicher Veröffentlichungen gemäß § 26 Mediengesetz
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.report.at/